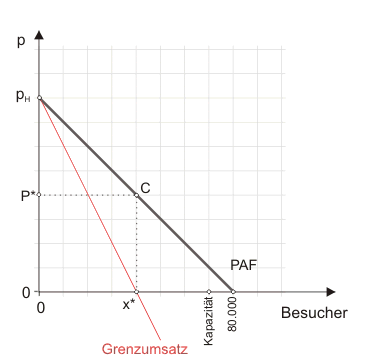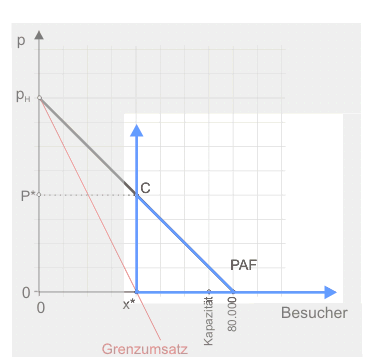Diese Seite funktioniert nur mit Javascript.
Messung der Anbieterkonzentration4.2.1.7 Monopolistische PreisdifferenzierungPreisbildung beim Oligopol
ls monopolistische Preisdifferenzierung oder -diskriminierung bezeichnet man das Verhalten eines Anbieters, von den Käufern unterschiedliche Preise für gleiche Güter oder Dienste zu verlangen. Umgekehrt gilt auch die Forderung gleicher Preise für Güter, die mit unterschiedlichen Grenzkosten erzeugt werden, als Preisdiskriminierung. Allgemein lässt sich sagen, dass Preisdiskriminierung vorliegt, wenn die Unterschiede in den Preisen nicht die Unterschiede in den Produktionskosten widerspiegeln.
Grundlegendes vorweg:
In welcher Weise - es werden diverse Arten unterschieden - Preisdiskriminierung lohnt, sei mit folgendem Beispiel verdeutlicht: Ein Konzertveranstalter hat eine Popgruppe verpflichtet, ein Fußballstadion mit einer Kapazität von 70.000 Besuchern als Veranstaltungsort angemietet, eine Marktanalyse betrieben usw. usw. Alle wesentlichen Kosten haben den Charakter von fixen Kosten: die Gage für die Band, die Stadionmiete, der Ordnungsdienst. Die variablen Kosten seien im Vergleich so gering, dass sie hier vernachlässigt werden.
Die Marktanalyse liefert die in Abbildung 1 wiedergegebene Preis-Absatz-Funktion. Die Sättigungsmenge liegt bei 80.000 Besuchern. Ohne variable Kosten bedeutet Gewinnmaximierung Umsatzmaximierung Mineralwassermonopol und der Veranstalter verlangt den halben Prohibitivpreis $p^*=\frac{1}{2}p_H$, denn bei 40.000 Besuchern sind die Grenzumsätze null.
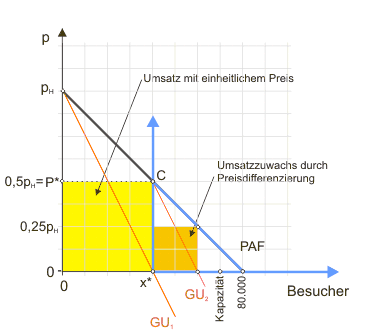
So simpel die Analyse ist, informiert sie immerhin, dass freie Plätze im Stadion nicht bedeuten, dass der Veranstalter etwas falsch gemacht hat. Obwohl das Stadion ein Fassungsvermögen von 70.000 Zuschauern hat, würde der Monopolist bei einem einheitlichen Preis nur 40.000 Konzertbesucher wünschen.
Aber um die freien Plätze ist es doch wirklich schade, schade, schade. Und es gibt auch noch Nachfrage, nur eben nicht zum Preis p*. Welche Nachfrage noch vorhanden ist, kann man sehen, wenn man die Maus über Abbildung 1 stellt. Nachdem der Monopolist 40.000 Eintrittskarten zum Monopolpreis p* abgesetzt hat, erkennt er die verbleibende Nachfrage. Die Situation unterscheidet sich prinzipiell nicht von der Ausgangssituation und der Veranstalter maximiert abermals den Umsatz aus der noch verbliebenen Nachfrage, wenn er weitere 20.000 Karten zum Preis von $p^*=\frac{1}{4}p_H$ verkauft (s. Abbildung 2).
Um die allokativen Konsequenzen der Preisdifferenzierung einzuschätzen, muss man sich zunächst klar machen, dass die gesellschaftlich optimale Zahl an Konzertbesuchern 70.000 wäre - rein theoretisch 80.000, aber so viele fasst das Stadion nicht. Ein weiterer Zuseher verursacht nämlich (annahmegemäß) keine Kosten, hat aber offensichtlich einen Nutzen, denn sonst wäre er ja nicht zahlungswillig. Das Konzert hat den Charakter eines öffentlichen Gutes, denn es liegt keine Rivalität im Konsum vor - so lange das Stadion nicht ausverkauft ist. Aus Sicht der Gesellschaft wäre es daher sinnvoll, wenn das Konzert so viele Besucher wie möglich hätte.
Im Vergleich zur Monopollösung mit einem einheitlichen Preis (40.000 Besucher) liegt die Lösung mit differenzierten Preisen (60.000 Besucher) näher am gesellschaftlichen Optimum. Es kommt somit zu einem geringeren Verlust an Wohlfahrt. Da nach der Preisdifferenzierung immer noch zahlungswillige Nachfrager vorhanden sind, könnte der Veranstalter den Preis ein weiteres Mal ermäßigen und würde im dritten Schritt mit einer optimalen Preisforderung in Höhe von $p^*=\frac{1}{8}p_H$ das Stadion mit weiteren 10.000 Besuchern, die diesen Preis zu zahlen bereit wären, genau füllen. Die gesellschaftlich optimale Zahl an Besuchern wäre erreicht.
Das Unbehagen, das man mit dieser allokativ effizienten Lösung verbindet, rührt wohl daher, dass man dem Monopolisten den Gewinn nicht gönnt. Bei der (für dieses Beispiel sehr) hypothetischen Konkurrenzlösung hätten ebenfalls 70.000 Besucher das Konzert verfolgt, sie wären aber kostenlos ins Stadion gekommen (Preis-Grenzkosten-Regel). Demgegenüber "zockt" der Monopolist so richtig Konsumentenrente ab.
Außerdem wäre denkbar, dass das Konzert ohne die Möglichkeit der Preisdiskriminierung gar nicht zustande gekommen wäre. Dann hätte auch keiner was davon gehabt, die Beteiligten keine Einkommen und die Besucher keine Freude. Das wäre dann der Fall gewesen, wenn der Umsatz ohne Preisdiskriminierung nicht ausgereicht hätte, die fixen Kosten zu decken, der Monopolist mit Preisdiskriminierung aber Gewinn erwirtschaften könnte.
Natürlich hätte der Veranstalter theoretisch die Preisdifferenzierung noch weiter treiben können. Im Extrem hätte er die gesamte Zahlungsbereitschaft der Besucher in Umsatz umwandeln können. Praktisch ist es aber offensichtlich unmöglich, die Preise entsprechend der Zahlungsbereitschaft jedes einzelnen Nachfragers zu differenzieren - jedenfalls dann, wenn die Zahl der Nachfrager groß ist und sie sich in ihrer Zahlungsbereitschaft unterscheiden.
Die im betrachteten Beispiel beschriebene Preisdifferenzierung wird als Preisdifferenzierung der ersten Grades bezeichnet. Als Preisdifferenzierung zweiten Grades bezeichnet man jene Fälle, in denen der Preis von der gekauften Menge abhängt (Mengenrabatt); als Preisdiskriminierung dritten Grades schließlich jene Fälle, in denen die Preise mit Merkmalen der Nachfrager variieren. Dies ist die häufigste Art der Preisdifferenzierung, der man tagtäglich begegnet - z.B. wenn Fahr- oder Eintrittskarten an Schüler und Studierende günstiger verkauft werden als an "normale" Kunden.
Mitunter ist die Unterscheidung nach der Gruppenzugehörigkeit nicht so offensichtlich. So könnte man z.B. meinen, Flugtickets für Linienflüge würden umso teurer, je kurzfristiger sie vor dem Abflug erworben werden, und entscheidend für die Preisdifferenzierung sei die Fristigkeit. Tatsächlich zielt diese Preisdifferenzierung aber wohl eher auf die unterschiedlichen Nachfrageelastizitäten von Urlaubs- und Geschäftsreisenden.
Die Preisdifferenzierung bei gruppenspezifischem Nachfrageverhalten bedarf keiner ausführlichen Erörterung. Wenn zwei getrennte Märkte vorhanden sind, dann ist es für den Monopolisten selbstverständlich gewinnmaximierend, auf jedem der beide Märkte den jeweiligen Monopolpreis zu verlangen. In aller Regel würde der Gewinn sinken, wenn der Monopolist auf beiden Märkten einen einheitlichen Preis fordern würde. Er müsste ja dazu auf wenigstens einem der beiden Märkte einen Preis verlangen, der nicht gewinnmaximierend ist. Tatsächlich würde er einen mittleren Preis fordern, den er nach der Regel Grenzumsatz gleich Grenzkosten bestimmen würde. Den Grenzumsatz hätte er dabei für die aggregierte Nachfrage beider Märkte zu berechnen.
Die denkbare Ausnahme ist, dass der Monopolpreis von vornherein auf beiden Märkten übereinstimmt. Das ist der Fall, wenn die Nachfrageelastizitäten auf beiden Märkten übereinstimmen, denn die direkte Preiselastizität der Nachfrage bestimmt, wie weit der Monopolpreis über den Grenzkosten liegt (s. Lerners Monopolgrad). Ansonsten wird der Monopolist auf dem Markt mit der geringeren Preiselastizität - was auf dringlicheren Bedarf der Konsumenten hinweist - den höheren Preis fordern: deswegen zahlen Frauen beim Friseur mehr als Männer, Geschäftsreisende für Flüge mehr als Urlaubsreisende und viele unserer europäischen Nachbarn für deutsche Autos weniger als Deutsche.
Ob die im hier betrachteten Beispiel durchgeführte Preisdifferenzierung tatsächlich durchsetzbar ist, hängt natürlich vor allem auch von den Erwartungen der Konsumenten ab. Hätten diese in der Vergangenheit beobachtet, dass der Veranstalter die Preise senkt, so würden sie sich unter Umständen strategisch verhalten. Warum sollten sie schließlich teuer kaufen, wenn sie damit rechnen können, dass es billiger wird?
Dieses Problem würde sich eher nicht stellen, wenn das Konzert nur ein einziges Mal veranstaltet wird. Entweder sie kaufen eine Eintrittskarte oder sie laufen Gefahr, dass sie keine bekommen. Was aber, wenn der Monopolist langlebige Gebrauchsgüter anbieten würde? Hier könnten die Konsumenten, denen es nicht so wichtig ist, das Gut frühzeitig zu besitzen Zeitpräferenz, ja in aller Ruhe abwarten, ob der Monopolist nicht mit dem Preis 'runter geht.
(Unrealistischerweise) Angenommen, alle Konsumenten würde das hier präsentierte Modell der Preisdifferenzierung kennen, dann wüssten sie ja, dass der Monopolist, wenn er seinen Gewinn maximieren will, mit einem hohen Preis beginnt, den er mit der Zeit bis auf die Höhe Grenzkosten herunter differenziert. Wenn die Konsumenten nun keine Präferenz haben, das Gut frühzeitig zu kaufen, und eine Vorstellung über die Höhe der Grenzkosten besitzen, dann werden sie keinen Preis zu zahlen bereit sein, der über den Grenzkosten liegt. Der Monopolist könnte das Produkt dann wie der Konkurrenzanbieter nur zu Grenzkosten verkaufen.